Erinnerung und Abschied
«Das Problem des Kunstbetriebs besteht darin, das richtige Verhältnis zu finden zwischen dem Ohrabschneider und dem Halsabschneider.»
Ach, was soll ich denn dazu noch sagen, sagte er, oder so ähnlich jedenfalls, und dann sagte er dann doch sehr viel. Das war etwa Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als der (vergleichsweise) junge Journalist sich ganz aufgeregt über den Kunst-Kommerz aufgeregt und ihn deshalb angerufen hatte: weil eben aber auch wirklich alles hinführte zu diesem Kunst-Kassandristen.
Ach Junge, schloß er im vergangenen Jahr die dann neuerlichen Aufregungen über diesen ständig um uns herumtrabenden Holzgaul aus Troia, in dem so viele Krieger wider die Kunst hocken und warten, bis sie sie endlich totmachen können, lies doch einfach. Lies! Das habe ich denn auch getan, damals und heute: Kunst, Neukunst, Kunstmarktkunst, zum Beispiel.
Er hatte gerne das (vor)letzte Wort. Also haben wir ihm letzteres gegeben (auf Seite 72). Dabei ist dies eines, das dort stehen müßte, wo er immer stand und dachte und ging (auch wenn das nicht mehr so richtig lief in den letzten Jahren): weit vorne. Aber Avant-Garde ist nunmal ein Begriff, den er eher dem Militärischen und damit Unaussprechlichen zuordnete, und wenn er doch von ihm ausgesprochen wurde, dann eher verhohnepipelnd. Und da er sich inmitten von Kurzschrift so wohlgefühlt (Kurzschrift 2/1999) hat wie seinerzeit im Laubacher Feuilleton, haben wir ihm eben den Platz eingeräumt, an dem er sich befand und der ihm auch und mehr noch nach seinem Tod am 9. Februar gebührt: mittendrin (und deshalb die Feder führend). ‹Der Makler und der Bohémien› heißt sein Stück aus den 70er Jahren, bei dem seinerzeit nicht unbedingt alle applaudierten (und dessen ‹Wiederaufführung› aus — den offensichtlich immer — aktuellen Gründen in Kurzschrift wir Mitte vergangenen Jahres vereinbart hatten).
Mit dieser kleinen Verbeugung soll aber auch auf einen weiteren Aspekt hingewiesen werden: Da planen hauptamtliche Mitarbeiter eines (west-)deutschen Kunstvereins eine Ausstellung, die unter anderem das Informel zum Thema hat. Doch sie kennen ihn nicht. Sie kennen ihn nicht als Maler, und sie kennen ihn nicht als deren vehementesten Kritiker. Auch die Situationistische Internationale soll dabei ins Bild, zur Sprache kommen. Als Anne Maier — die dem Vorstand dieses Kunstvereins angehört — darauf verweist, daß man bei diesen Themata wohl kaum um ihn herumkomme, fehlt selbst dem künstlerischen Leiter letztere, wußte er, der Direktor eines Kunstvereins, doch nicht, daß Hans Platschek der deutsche spiritus rector dieser geistigen Rolle vorwärts war: eines der letzten Streitrösser der neueren Kunstgeschichte. Und wem von den Zeitgenossen mit der, um die gekonnt flapsige Bemerkung von Anne Maier heranzuziehen, «leicht eingeschränkten Halbwertzeit» denn dafür das Vokabular fehlte, dem half der 1923 geborene Meister der Kunst-Ketzerei in der ihm eigenen Sprachvirtuosität persönlich auf die Fährte der Erinnerung. Über die Dummheit in der Malerei (1984) war einer dieser die platscheksche Diktion so kennzeichnenden Titel, die eigentlich zur Pflichtlektüre von Absolventen kunsthistorischer Fakultäten gehören sollte.
Hans Platschek war immer auch das, was ohne Unterlaß (und in einfältiger Weise) dem Kunstkritiker vorgeworfen wird, es nicht zu sein: Künstler. Und auch mit eben dieser, seiner Malerei (Biennale Venedig 1958 und documenta II 1959) war Platschek heftig diskutiert, es ließe sich auch behaupten: umstritten. Denn lange bevor die Alles-ist-machbar-Generation Francis Picabias Diktum vom runden Kopf und den sich darin bevorzugt richtungsändernden Gedanken (mit dem Wissen von «leicht eingeschränkter Halbwertzeit») adoptierte, malte Platschek diese Wechselbewegung. Eben noch Mitbegründer des deutschen Informel, besann er sich der Figuration, um dem Öl dann, als die Kunstbeschreibung meinte, in ihrem Kopf endlich eine Richtung für ihn gefunden zu haben, nämlich die der Orientierungslosigkeit, auch schon wieder eine andere Fließgeschwindigkeit zu geben.
Hans Platschek hatte zwar oft die Schnauze voll. Aber der Schaum trat ihm nie vor den Mund, diese (Tob-)Sucht war nicht die seine. Es war durch die Zeilen gefilterte Klarheit, und die sollte noch in ein gemeinsames Buchprojekt fließen — mit dem Verlag Christina Schellhase. Doch jetzt müssen wir alleine schreiben (was wir im folgenden versucht haben). Also mischen wir die Tränen der Trauer mit der Asche der vielen, vielen Zigaretten, die wir noch auf ihn rauchen, und lassen sie hineinfallen in die Whiskies, die wir noch auf ihn trinken.
dbm
Nicht im Heft: Hans Platschek starb, wie ein Held der Künste im Kino des Lebens sterben muß, mit den Stiefeln voraus wurde er er aus dem Saloon getragen: Nach seinem Whisky nahm er eine letzte Zigarette und schlief darüber ein. Per Schwelbrand ins Nirwana. (jst)
Kurzschrift 3.2000, S. 5f.
| Fr, 12.03.2010 | link | (2239) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Letzte Worte |
Hans Pfitzinger †
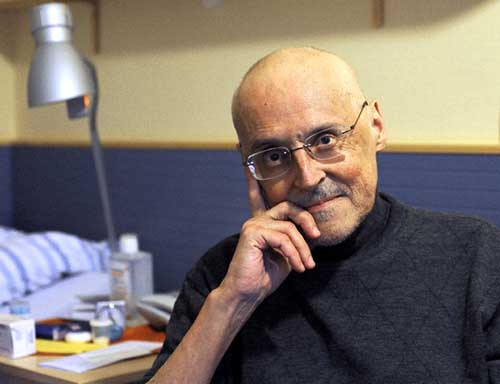
Liebe Freunde von Hans Pfitzinger,
Hans ist heute früh von uns gegangen.
er war sehr schwach zum Schluss, aber furchtlos und neugierig,
auf das, was kommen mag.
Er hat es als große Gnade empfunden,
bis zuletzt keine Schmerzmittel zu benötigen,
und verschied friedlich, mit vollem Bewusstsein.
Er wollte wissen.
«Wer vor dem Sterben zu sterben gelernt hat,
wer sich mit dem Tode angefreundet hat, hört auf, Knecht zu sein.
Er ist aller fremden Macht und Gewalt überlegen.
Wer lebt, nachdem er sein Dasein zu höchstmöglicher Vollendung geführt hat,
ist erhaben über die Wandlungen des Schicksals.
Er ist frei.»
(Seneca)
Wenn ich weiss, wo und wann die Trauerfeier sein wird,
melde ich mich per Email.
Axel Ganguin
Wann genau es war, weiß ich nicht mehr — irgendwann Mitte der siebziger Jahre, 1975 vielleicht, es mag auch 1976 gewesen sein. Aber an eines erinnere ich mich präzise, es hat festgemacht wie ein Standphoto aus einem Stück gemeinsamen Lebens. Ein graues Sakko hatte er an, darüber ein kalifornienbestrahltes Gesicht, von dem ich heute meine, es könnte Spuren eines damals in seiner Zwischenheimat hochgeschätzten Anti-Doping-Mittels gezeigt haben. Ich komme deshalb darauf, weil Ben ihn mir vorgestellt hatte, auch er aus dem Leben geschickt von dieser Krankheit, die hap, wie Hans bei uns bei seinem Kürzel genannt wurde, jetzt verabschiedet hat. Um die Ecke sollten wir ein paar Tage später, Ben, Hans, Mike und ich einen ganzen Nachmittag lang über eine Wiese bunten Lachgrases hüpfen, bis wir erschöpft in den Seilen des sommerlichen Hinterhofbalkons in der Münchner Türkenstraße hingen. Dieses Lächeln mag aber auch diesen offenbar uferlosen Optimismus gezeigt haben, den er aus dieser Aufständischen-Universität Berkeley, wo er nach der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität noch einige Semester Politische Wissenschaften absolvierte, mitgebracht hatte. Den entscheidenden Teil dieses Bildes auf der Adalbertstraße habe ich ebenso prägnant in Erinnerung. Auf meine Frage, was er denn nun hier zu tun gedenke, war seine knappe Antwort: Den Journalismus neu erfinden.
Wäre er nicht tot, müßte ich nun schreiben, daß er das vermutlich tun wird bis an sein Lebensende. Er hatte eine gänzlich andere Auffassung davon als der Journalismus, der sich bis heute gehalten hat. Er war ziemlich wütend, als Christina Schellhase und ich 1996 das Laubacher Feuilleton, für ihn und andere überraschend, verabschiedeten. Als wir uns wieder vertragen hatten, lieferte er eine Begründung für sein Schäumen nach: Er liebe das Blattmachen halt so. Und unser Blättchen hatte tatsächlich etwas von dem, das uns einte und weshalb es schließlich gegründet worden war. Annemarie Monteil hatte diese Gemeinsamkeit unnachahmlich in Worte gefaßt: Nabel der Welt. Hans Pfitzinger war (fast) von Anfang an dabei, er gehörte nicht nur zu den harten Aktivisten unserer Blauen Stunden, die das eine ums andere Mal auch so endeten — wenn er bei dieser Art der Geistsucherei auch einer der Zurückhaltensten war —, er fehlte nie. Auch nicht in seinen Anmerkungen zur Welt, von denen hier nur ein Bruchteil dokumentiert ist (was verfügbar ist, wird nachgetragen; im übrigen sei auf das Archiv der Gazette verwiesen, wo er weiter Blatt machte und in der recht viel des pfitzingerschen Verständnisses von Journalismus nachzulesen ist). Wie man seine Texte auch drehte und wendete, irgendwie hatte er immer recht. Deshalb war er immer im Blatt vertreten, nicht nur als Autor, sondern auch als Lieferant dessen, das unbedingt erneut veröffentlicht gehörte, zum Beispiel immer wieder diese Romantiker, die ein sehr viel anderes Weltbild abgaben, als diese Epoche gemeinhin wahrgenommen wird: E.T.A. Hoffmann und sein fränkischer Landsmann Jean Paul, für den er immer wieder Liebeserklärungen abgab wie hier in Die Gazette, den er so sehr liebte, daß er ihn sich auch schonmal zur Brust nahm. Das tat er auch mit der Zeitung, die er in die Richtung zurückschieben wollte, von der er meinte, daß sie die einzig gültige sei. So richtig genossen hatte das Blatt das nie, was aus dem verschämten Nachrüfchen ersichtlich wird. Aber wer hier gescheitert ist, der Erfinder eines neuen Journalismus oder der alte, unausrottbare selbst, das wird sich weisen. Aber das dürfte ihn kaum mehr interessieren können, den Hans.
hap und ich haben uns ein wenig aus den Augen verloren die letzten Jahre. Das ist jedoch in erster Linie geographisch bedingt. Es ist gut möglich, daß er mir in naher Zukunft derart aufleuchtet, auf daß ich mich noch einmal persönlicher zu Wort melden muß. Aber nun mag ich zunächst einmal in mich gehen.
| Di, 23.02.2010 | link | (6974) | 1 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Letzte Worte |
Strahlkraft
«Preisnotierung aus dem Getränkefachhandel: DM 5,95 für eine Flasche englischen Mineralwassers. Keine Zukunftsvision auf das Jahr 2007, vielmehr Alltagsrealität von 1993. Dem Wasserunkundigen hat der Inhalt vergleichbaren Liquiden gegenüber kaum einen schmeckbaren Qualitätsvorsprung, der eine derart exorbitante Preisdifferenz rechtfertigen würde. Es kann also nur an der spezifischen Natur der Verpackung liegen, wenn der Kunde solche Unverfrorenheit hinnimmt. Das Etikett informiert uns, daß die Flasche einen Preis für Glasdesign errungen hat. Dies wohl zum geringeren Teil wegen ihrer unübersehbaren Keulenform eines entsprechenden französischen Produkts nachempfundenen Gestalt, sondern eher an der Farbe des Glases, einem Blau von intensiv-transparenter Strahlkraft unweit der Schmerzgrenze. Eine Auszeichnung also durch letztlich zwei Preise für Farbe. Sei's gepriesen.»
Das ist ein Text unseres Beirats Bernhard Holeczek mit dem Titel Drei Paralipomena. Er stammt aus dem Ausstellungskatalog Open Space zu Nikolaus Koliusis im Kasseler Kunstverein von 1993. Als ich diese Zeilen gelesen hatte, überkam mich Begeisterung und Erinnerung gleichermaßen — Katalysatoren eines Telefax' nach Ludwigshafen am Rhein (aus der Erinnerung): Ich möchte diesen Text im Laubacher Feuilleton nachdrucken! Die Antwort: 1.: ich freu' mich, daß das Blättchen immer noch existiert; 2.: daß ich immer noch bemustert werde; 3.: gerne.
Der Text, ein klassisch feuilletonistischer und ganz im Sinne des Laubacher Feuilleton, weshalb ich ihn so schön fand und immer noch finde, wurde bislang bei uns nie (nach-)gedruckt. Erst paßte er nicht hinein ins Blatt, dann nicht aus ‹gestalterischen› Gründen, weil das sich ergebende ‹Loch› eben nicht vorhanden war, später geriet er, mal in den Stehsatz geraten, in Vergessenheit. Jetzt soll er, wie so viele andere Texte und deren Autor, nicht mehr in Vergessenheit geraten, denn er ist tot — der Autor.
Am Tag des Beginns der Auslieferung unserer Nummer 12, etwa ein Jahr nach Erhalt dieses Katalogs, den Bernhard Holeczek auf Grund meines Telefaxes und damit aus freundschaftlicher Freude heraus noch eigenhändig eingetütet hatte, und damit des Textes, erhielt ich die Todesnachricht.
Es wird viel gestorben in den letzten Jahren — außerordentlich. Dies allerdings ist ein Tod, der, wie das nun einmal ist mit (gestorbenen) Freunden, besonders ans Erträgliche geht. Es ist ein Tod, den allerdings ‹Stab› und Leser des Laubacher Feuilleton gleichermaßen berühren muß: Denn Bernhard Holeczek war der Initialzünder des Laubacher Feuilleton — ohne ihn gäbe es unser Blättchen nicht.
Kurz: Als ich im Sommer 1991 in Ludwigshafen an seinem Schreibtisch im Wilhelm-Hack-Museum, das er dirigierte, saß und die täglich-wöchentlich-monatlich-vierteljährliche Feuilleton-Situation beklagte und daß ich eine Idee hätte und daß ich aber nicht wisse, ob denn so etwas heute überhaupt realisierbar sei, sprach er (vermutlich den 35. Kaffee schlürfend und die 50. Zigarette rauchend): Hör' auf zu jammern, mach's doch einfach!
In demselben, erwähnten Katalog, steht noch noch ein — aphorismusgleicher Satz von Bernhard Holeczek:
«Wenn du das Licht suchst, bist du allein,
wenn du es gefunden hast, sind alle da.»
Laubacher Feuilleton 13.1995, S. 15
| Di, 13.10.2009 | link | (3165) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Letzte Worte |
Lieber verhungert

Betroffenheit. Was für ein Wort. Schrecklich. Unser marxistischer Melancholiker hätte vermutlich gesagt: «Gestrichen. Gehört zur Liste der Unwörter. Genauso wie Anliegen. Hat Adorno verboten.»
Aber was will man machen, wenn man ein Anliegen hat und einem vor lauter Betroffenheit nichts anderes einfällt, als schlicht Betroffenheit zu verkünden? Rat holen ist nicht (mehr). Adorno ist tot, und Manfred Jander sagt auch nichts mehr. Also: Getroffen?
Auf jeden Fall schlimm. Sehr schlimm. So schlimm, daß unsereins in ein Loch verschwinden möchte, in das gerade mal ein Semikolon hineinpassen würde; er gehörte zu den letzten, die wußten, wo Satzzeichen hingehören. Doch es ist zu bezweifeln, ob diese Scham überhaupt irgendwo verschwinden kann. Vermutlich paßt sie nicht einmal in das Loch dieses gigantischen Ausmaßes, das diese alternden Arbeitslosen in die bundesdeutsche Haushaltskasse gerissen haben.
Nun ist Manfred Jander bereits 2003 gestorben. Aber erst gestern abend (20. Oktober 2007) hat unsereins die Nachricht von seinem Tod mitgeteilt bekommen. Deshalb und der Gründe seines sogenannten Ablebens wegen machen wir ihn und unser schlechtes Gewissen hier(mit) öffentlich.
Manfred Jander (maj) gehörte von Beginn an zum harten Kern des Laubacher Feuilleton, diesem «Eiland im Meer des Mangels» (Süddeutsche Zeitung), war der immer kritische, aber kraft seiner Duldsamkeit auch moderierende «Geist einer kauzigen, wohl auch ein wenig elitären Gelehrtenrepublik […]: eine Festung gegen den Unrat der Mediengesellschaft» (Zürcher Tagesanzeiger). Er war der politisch(st)e Kopf dieser feuilletonistischen Hydra «mit Biß und Witz, Lust und Anklage über die Jahrhunderte oder Jahrzehnte hinweg mitten in unsere Gegenwart» (Basler Zeitung). Er war bibelfester als der Papst. Hätte Karl Marx nicht mehr gewußt, wo er was geschrieben hatte, Manfred Jander hätte ihm sagen können, an welcher Textstelle eine leichte Müdigkeit über ihn kam oder er elektrisiert war, wenn es darum ging, für ein menschlicheres Dasein zu kämpfen. Das hat er getan, bis zum wahrlich bitteren Ende: kämpfen. Nicht Marx. Jander. Keinen Menschen hat unsereins kennengelernt, der so sattelfest jeden Kritiker der marxschen Theorie widerlegt hätte. Die klappentextgebildeten Daherplappernden hat er, der nicht einmal über außerordentliche rhetorische Fähigkeiten verfügt hatte, kraft seines Wissens rasch demaskiert. Und Jander hat ihn gelebt, den Sozialismus. Weil er sie geliebt hat, die Vorstellung, eines Tages könnte es doch noch zu einem besseren Leben für alle reichen.
Manfred Jander stammte aus dem Remstal, in der Nähe von Stuttgart. Dorthin ist er jeden frühen Morgen zu seiner Lehre als Schriftsetzer gefahren. Das war eine Zeit, in der einer, der die Schrift setzen wollte, die Sprache im besten Wortsinn im Griff hatte. Mehr: Er hat auch darüber nachgedacht. Das wurde immer wieder deutlich, als unsereins mit ihm als Korrektor zu tun hatte. So manches Mal machte er auf Fehler aufmerksam, über die manch einer nicht einmal leicht ins Stolpern geraten wäre. Und als es darum ging, 1991, quasi zwischen Weihnachten und Neujahr, den weit über vierhundert Seiten dicken US-amerikanischen Katalog Entartete Kunst für das Berliner Deutsche Historische Museum in hiesiges Geschichtsverständnis zu übersetzen, hat Manfred Jander sehr oft auch ein paar der Fakten geraderücken müssen, mit denen unsere amerikanischen Freunde sich einfach nicht anfreunden wollen. Nach seiner Lehre hatte unser Hauskorrektor über den zweiten Bildungsweg den universitären der Historie und Soziologie beschritten. Auch hier saß er eben fest im Sattel.
Was lag für einen, der sich den Aufstieg vom Arbeiterkind auf den akademischen Olymp hart erarbeitet hatte und dem so sehr am Menschsein gelegen war, näher, als anderen ebendiesen Weg zu ebnen? Zu einer Zeit, als die Gewerkschaften noch so verzettelt waren wie die deutschen Lande zu Zeiten Hugo von Hoffmannstals — der deshalb ein Lied der Deutschen schrieb, das die Einigkeit und das Recht und die Freiheit in einem deutschen Vaterland herbeisingen sollte —, als die Arbeitnehmer-Vertretungen also die Gemeinsamkeit anstrebten, bildete Manfred Jander beim Deutschen Gewerkschaftsbund Erwachsene aus.
Diese Vereinigung für die Rechte der Arbeitnehmer hatte ihm dann den Arbeitsplatz genommen, indem sie aus sogenannten Einsparungsgründen die Stelle strich. Danach schickte ihn das Arbeitsamt in Schulungen, auf daß er das lerne, was er über zwanzig Jahre lang gelehrt hatte. Zwar lehrte er seine Lehrer rasch, was die ihn lehren sollten, doch Arbeit wollte ihm trotzdem niemand mehr geben. Zu alt, nicht mehr vermittelbar.
Nachdem das Laubacher Feuilleton 1996 nach zwanzig Ausgaben eingestellt worden war (da der Tag nunmal nicht mehr als achtundvierzig Stunden hat) und die wöchentlichen Blauen Redaktionsstunden, zuletzt im Cocorico in der Münchner Schellingstraße, abgelaufen waren, zerstreute sich die Kernbelegschaft in alle Richtungen: die einen in die Hansestadt nach Norden, die anderen in deren Schwesterstadt tief unten im Süden. Doch Manfred Jander hatte ohnehin schon zuvor seine eigenen Ruheplätze. Doch selbst die Rheinpfalz in der Kurfürstenstraße besuchte er immer seltener. Der Weg von seiner Wohnung in der Belgradstraße dorthin ließ sich mit Krücken schlecht an. Also taperte er lieber die paar Meter zu der Kneipe, die ihm ohnehin eine Art Wohnzimmer war, ins Zum Zum am Kurfürstenplatz. Dort bekam er nicht nur seine Halbe oder auch drei. Auch brachte man ihm dort die Zuneigung und Wärme entgegen, die ihm gebührte. Und die wir versäumt haben.
Versäumt. Welch Wort. Nun gut, unsereins hatte ihn nochmal getroffen. Nicht im Zum Zum. Das hatte man dichtgemacht; es war nicht mehr profitabel, und so ein paar Herumhänger, die am Monatsende ihre Stütze am Tresen ablieferten, um die Tankrechnung zu bezahlen, werfen nunmal nicht genug ab und verhäßlichen der Jeunesse vis-à-vis das Blickfeld. Schräg gegenüber hatte man sich mittlerweile seiner angenommen. Dort erzählte dann der eine von seiner sonnigen, südlichen Heimat und seiner neuen Familie, und der andere lächelte dazu mit traurigen Augen, in denen sich bereits das Graue(n) des verlorenen Kampfes spiegelte. Der eine versuchte später noch ein paarmal, den anderen zu erreichen. Aber ans Telephon ging der nicht mehr.
Das konnte er auch nicht. Denn Tote telephonieren nicht. Gestern nun las ersterer zufällig in einem Impressum, quasi als letzte Ehrung: «Manfred Jander (1940 – 2003)». Die Antwort von Joachim F. W. Lotsch auf die Anfrage lautete: «Er starb im Kampf. Im Kampf um sein Recht auf Selbstbestimmung und Menschenwürde. Im Kampf gegen die Behörden, die ihm Sozialleistungen nur gewähren wollten, wenn er seine kleine Eigentumswohnung verkaufen würde. Da ist er lieber verhungert.»
Und da er nicht mehr widersprechen kann, schreibt ganz leise: Betroffenheit
dbm
hap (04.03.09, 21:26
Issja nun wirklich
nicht so, dass ich das nicht schon mal gelesen hätte, aber ganz von Manfred abgesehen: Ich kann mich beim besten Willen an keinen Nachruf erinnern, bei dem mir bei jedem Wiederlesen die Tränen an den Rand der Augenränder steigen.
Und von dem Foto will ich gar nicht erst anfangen.
edition csc (05.03.09, 05:26)
Eine etwas größere
Version dieser etwa 1993 in Norddeich während einer anhaltenden LF-Übung des Deckelrundtrinkens entstandenen Aufnahme befindet sich auf Stubenzweigs Bildchenseite. Damals ging unser oberster Stubenhocker sogar lange vor allen anderen ans Meer, aß dort riesige Becher mit Eis und Früchten und nahm anschließend ein Weißbier, alles Genüsse, die er sich in München nie gönnte. Aber auf dem Bild bekam er selbstverständlich sein abendliches Pils, serviert von Stumpi, vor dessen Fährkeller-Tür wir um 17.00 Uhr immer schon gewartet hatten. Danach ging's in den Knurrhahn, um den Fisch zu ertränken, sowie anschließend ins Nordlicht, um den Deckel endgültig rund zu machen. Aber Manfred war am nächsten Morgen immer wieder der erste. Da blickte er immer noch ziemlich fröhlich in die Zukunft. (Ich habe eben etwas entdeckt und eingestellt, das die Meeresabenteuer skizziert.)
| Do, 24.09.2009 | link | (4812) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Letzte Worte |
Künstler-Philosoph
«Was ist Kunst? Was kann Kunst? Welche Verantwortung trägt der Künstler? Wie kann Kunst unser Leben und unsere Sicht der Dinge bereichern? Fragen, die soviele Antworten wie Irrtümer provozieren. Quälend, bohrend und in ihrer existentiellen Wahrhaftigkeit gefährlich.» Mit diesen Sätzen charakterisierte Christoph Wiedemann in der Süddeutschen Zeitung vom 21. März die Intentionen des ‹Künstler-Philosophen› Thomas Lehnerer, promovierter Theologe und Kunstheoretiker; sozusagen Inkarnation des Liebevoll-Freundlichen, für die Menschennähe eines der Hauptkriterien ihrer Kunst war. Er wollte noch so vieles bewegen, formen. Aber seine Krankheit, die sein zentrales Nervensystem mehr und mehr lahmlegte, hat ihn nicht lassen. Er ist, noch nicht einmal 40 Jahre alt, gestorben.
Auf dem Kudamm war's, im Sommer vor drei Jahren. Wir saßen zusammen in einem feinen Restaurant, in das uns Freund Kutte zu seinem geliebten Lachs-Frühstück eingeladen hatte. (Später sollten wir, dank seiner Führung, einen historisch-spannenden Rundgang durchs Ost-Berliner Scheunenviertel machen, wo er lange gelebt hatte.) «Ach wißt ihr», sagte er, wobei er nur wenige unserer zahlreichen Zigaretten immer nur anzünden wollte, «wenn jetzt tatsächlich Ende wäre, wär's vermutlich nicht weiter tragisch — ha' ick doch'n janz jutet un' schönet Leb'n jehabt.»
Dieses gute und schöne Leben unseres Freundes ist im März dieses Jahres zu Ende gegangen — der Lungenkrebs hat Kurt Goldstein dahingerafft. Er ist 48 Jahre alt geworden.
Laubacher Feuilleton 14.1995, S. 15
| Do, 24.09.2009 | link | (2088) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Letzte Worte |
weiterblättern ist das anwachsende Archiv der édition csc, mittlerweile in aktueller Fortsetzung. Partenaire, Partner.
Letzte Aktualisierung: 05.12.2013, 18:31
Zum Kommentieren bitte anmelden.
Links:
... Aktuelle Seite
... Inhaltsverzeichnis
... Autorinnen und Autoren
... Inwendiges
... Impressum
... Blogger.de
... Spenden
Letzte Kommentare:
/
Biographische Notiz
(edition csc)
/
Martin Knepper
(edition csc)
/
Enzoo (52 [2.10.2012]):
(edition csc)
/
Liebe virtuelle Verleger,
(edition csc)
/
Unglaublich
(jean stubenzweig)
/
Herbert Köhler
(edition csc)
/
Das sehen wir
(edition csc)
/
Guter Artikel!
(wolfganggl)
/
nur konsequent, dass storck...
(vert)
/
Telephon-Spiele
(edition csc)
/
Ein Porträt
(edition csc)
/
Unser Häus'chen
(daniel buchta)
/
Die bagonalistische Ballastung
(edition csc)
/
Dictionnaire
(edition csc)
/
Eine Antwort
(edition csc)
/
Please copy
(einemaria)
/
kid37, "We learned more from...
(kreuzbube)
/
Der bildenden Zeitung
(edition csc)
/
Da sieht man es. Nicht in...
(kid37)
Privatsphäre:
Suche:
Links:
... Aktuelle Seite
... Inhaltsverzeichnis
... Autorinnen und Autoren
... Inwendiges
... Impressum
... Blogger.de
... Spenden
Letzte Kommentare:
/
Biographische Notiz
(edition csc)
/
Martin Knepper
(edition csc)
/
Enzoo (52 [2.10.2012]):
(edition csc)
/
Liebe virtuelle Verleger,
(edition csc)
/
Unglaublich
(jean stubenzweig)
/
Herbert Köhler
(edition csc)
/
Das sehen wir
(edition csc)
/
Guter Artikel!
(wolfganggl)
/
nur konsequent, dass storck...
(vert)
/
Telephon-Spiele
(edition csc)
/
Ein Porträt
(edition csc)
/
Unser Häus'chen
(daniel buchta)
/
Die bagonalistische Ballastung
(edition csc)
/
Dictionnaire
(edition csc)
/
Eine Antwort
(edition csc)
/
Please copy
(einemaria)
/
kid37, "We learned more from...
(kreuzbube)
/
Der bildenden Zeitung
(edition csc)
/
Da sieht man es. Nicht in...
(kid37)
Privatsphäre:
Suche:
