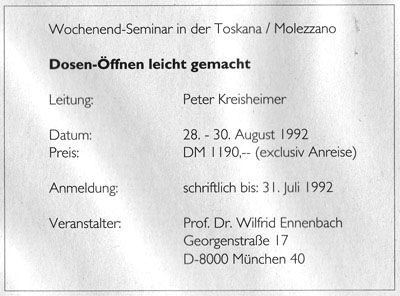Die Essenzansage
Studie zur vormahlichen Ansage im Kontext einer Kochveranstaltung.
Der letzte Buchstabe im Alphabet des Deutschen verändert das Essen zur Essenz. Zu etwas Wesentlichem. Mit nur geringem klanglichem Unterschied ist eine Essensansage – man hebe die zweite Silbe – eine Essenzansage.
Hören wir genauer hin. Was ist eine Essenz? In der Kochkunst spricht man von Fonds, ob Bratenfond, Gemüsefond, Geflügel- oder Fischfond, die Soße ist die Essenz. Sie bestimmt das So-Sein, wobei Soße immer eine doppelt plurale Bestimmung meint: Etwas ist so, aber besteht aus mehreren Sos, und doppelt plural bilden wir von den Sos ein weiteres Mal die Mehrzahl und erhalten die Soße.
Eine Soße ist niemals ein einfaches, sondern immer ein mehr als zweifaches Geschmackserlebnis.
Wenden wir uns der dem Kochen verwandten Alchimie zu, so spricht diese von den Grundelementen, den Essenzen, aus denen alles Sein besteht. Ein Braten gleichwie eine Suppe ist ein Aspekt, ein spezifisch kreierter Anteil des zur Wirklichkeit gewordenen Möglichen.
So wie also ein Hund sowohl ein Pudel als auch ein Mops sein könnte, benennen wir bei einer Essenzansage nicht etwas Bestimmtes, gar etwas immer Gleiches und Sicheres, dessen So-Sein unüberprüft verschlungen werden kann. Statt dessen haben wir es mit unterschiedlichen So-ßen zu tun, also einem unterschiedlich möglichen Wesentlichen.
Die Philosophie stellt die Frage: «Was ist das?» Es ist die Frage nach dem Substantiellen. Sie erinnern sich vielleicht an ihre Kinderzeit und die Begegnung mit Spinat. Oder sie sind gereist und neuen Speisen begegnet. Dann kommt es zur sogenannten Frage der Speisekarte: «Was ist das?»
Die Antwort ist einfach. Entweder ich esse das oder es bleibt fremd. Was das isst, bin ich, und esse ich es nicht, erfährt die Essenz-Frage keine wirkliche, keine mögliche Antwort. Wohl können Sie intellektuell-sprachlich erfahren, was das isst, indem es Ihnen gesagt wird, aber damit ist die substantielle «Was ist das-Frage» noch lange nicht gegessen.
Das unterscheidet die Essenzansage von der Essenzerfahrung. Guten Appetit.
Friedhelm Kändler
Anm.: Wie bekannt, wurde ‹ißt› zum dümmlichen ‹isst› rechtschreibreformt; eine Erwähnung der substantiellen Liaison der Buchstaben ‹s› und ‹z› hin zum ‹ß› sowie weiterer Zusammenhänge soll hier unberücksichtigt bleiben. Nur soviel: Die Tendenz der Enthistorizierung von Sprache darf sich nicht wundern, wenn sich auch der Begriff ‹Verständnis› in seiner Essenz mehr und mehr zu einem mantelumhüllten Wesen halb- oder nichtwissender Vernutung wandelt.
Hören wir genauer hin. Was ist eine Essenz? In der Kochkunst spricht man von Fonds, ob Bratenfond, Gemüsefond, Geflügel- oder Fischfond, die Soße ist die Essenz. Sie bestimmt das So-Sein, wobei Soße immer eine doppelt plurale Bestimmung meint: Etwas ist so, aber besteht aus mehreren Sos, und doppelt plural bilden wir von den Sos ein weiteres Mal die Mehrzahl und erhalten die Soße.
Eine Soße ist niemals ein einfaches, sondern immer ein mehr als zweifaches Geschmackserlebnis.
Wenden wir uns der dem Kochen verwandten Alchimie zu, so spricht diese von den Grundelementen, den Essenzen, aus denen alles Sein besteht. Ein Braten gleichwie eine Suppe ist ein Aspekt, ein spezifisch kreierter Anteil des zur Wirklichkeit gewordenen Möglichen.
So wie also ein Hund sowohl ein Pudel als auch ein Mops sein könnte, benennen wir bei einer Essenzansage nicht etwas Bestimmtes, gar etwas immer Gleiches und Sicheres, dessen So-Sein unüberprüft verschlungen werden kann. Statt dessen haben wir es mit unterschiedlichen So-ßen zu tun, also einem unterschiedlich möglichen Wesentlichen.
Die Philosophie stellt die Frage: «Was ist das?» Es ist die Frage nach dem Substantiellen. Sie erinnern sich vielleicht an ihre Kinderzeit und die Begegnung mit Spinat. Oder sie sind gereist und neuen Speisen begegnet. Dann kommt es zur sogenannten Frage der Speisekarte: «Was ist das?»
Die Antwort ist einfach. Entweder ich esse das oder es bleibt fremd. Was das isst, bin ich, und esse ich es nicht, erfährt die Essenz-Frage keine wirkliche, keine mögliche Antwort. Wohl können Sie intellektuell-sprachlich erfahren, was das isst, indem es Ihnen gesagt wird, aber damit ist die substantielle «Was ist das-Frage» noch lange nicht gegessen.
Das unterscheidet die Essenzansage von der Essenzerfahrung. Guten Appetit.
Friedhelm Kändler
Anm.: Wie bekannt, wurde ‹ißt› zum dümmlichen ‹isst› rechtschreibreformt; eine Erwähnung der substantiellen Liaison der Buchstaben ‹s› und ‹z› hin zum ‹ß› sowie weiterer Zusammenhänge soll hier unberücksichtigt bleiben. Nur soviel: Die Tendenz der Enthistorizierung von Sprache darf sich nicht wundern, wenn sich auch der Begriff ‹Verständnis› in seiner Essenz mehr und mehr zu einem mantelumhüllten Wesen halb- oder nichtwissender Vernutung wandelt.
| Fr, 25.10.2013 | link | (3695) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Gastrosophisches |
Schlichtere Nahrung
«Erdeessen, die bei vielen Völkern beobachtete Gewohnheit, Erden von gewisser Beschaffenheit zu essen. Diese Gewohnheit findet sich z. B. in den Sandsteingruben des Kyffhäuser und im Lüneburgischen, wo die Arbeiter einen feinen Ton, die sogen. Steinbutter, auf das Brot streichen. Andre Gegenden Europas, in denen E. vorkommt, sind Steiermark, Oberitalien (Treviso), Sardinien, wo Erde wie andre Lebensmittel auf den Markt gebracht wird, der äußerste Norden von Schweden und die Halbinsel Kola, wo freilich die Erde, eine als Bergmehl bezeichnete Infususorienerde, Unter das Brot verbacken genossen wird. Als Leckerbissen dient Erde in großer Menge in Persien trotz eines in neuerer Zeit erlassenen Verbots. In den Basaren kauft man einen weißen, feinen, etwas fettig anzufühlenden Ton und unregelmäßige, weiße, feste Knollen, die sich feinerdig anfühlen und etwas salzig schmecken. Auch die Damen der spanischen und portugiesischen Aristokratie betrachteten einst die Erde von Ertemoz als große Deilikatesse. Neben diesem Gebrauch, die Erde als Nahrungsmittel zu genießen, der sich auf alle Tropenländer und viele subtropische Gebiete erstreckt und in Amerika und Afrika am verbreitesten ist, findet sich z. B. in Nubien die Sitte, Erde als Arzneimittel zu genießen.An anderen Orten ist diese Sitte mit religiösen Motiven vermischt, un an andern erscheint sie als religiöse Handlung allein, wie auf Timor. Für die so weit verbreitete Sitte des Erdeessens dürfte es viele, grundverschiedene Ursachen geben. Nicht ausgeschlossen ist, daß die Erde einen gewissen Wohlgeschmack hervorrufen könne; abgesehen davon sind viele Erdarten salzhaltig, so daß der genuß der Erde in vielen Fällen als Ersatz des Saltzgenusses angesehen werden kann. Ferner kommt E. im Verlauf verschiedener, zumeist in den tropen heimischer Krankheiten vor, namentlich bei der durch den Darmschmarotzer Anchylostomum duodenale (s. d.) hervorgerufenen Anämie. Charakteristisch für den pathologischen Erdeesser ist der Hängebauch, allgemeine Abmagerung, Anschwellung der Leber und Milz. Auffällig ist die Häufigkeit des Vorkommens pathologischen Erdeessens im kindischen Lebensalter. Schließlich kann das E. auch einen perversen Nahrungstrieb darstellen, wie er sich bei Bleichsüchtigen und Hysterischen, auch bei jüngern Mädchen findet (Pica chlorotica), die z. B. Kreide, Schiefer, Griffel in den Mund nehmen und daran kauen, auch alten Mörtel essen.»
Aus: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Sechste, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage, sechster Band, Bibliographisches Institut, Leipzig und Wien, 1909, S. 1
Laubacher Feuilleton 1993, S. 16
| So, 21.10.2012 | link | (1695) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Gastrosophisches |
Traumhafte Nahrungsressourcen

Ich hatte einen Traum, am Wochenende, und der erheiterte mich dermaßen, daß ich laut lachend erwachte und ihn sogleich meiner weniger begeisterten Nebenbeischläferin erzählen konnte, so daß er nicht in nächtlichträumerische Vergessenheit geraten konnte. Außerdem hatte er mit seltsamen Tieren zu tun. Also, der Traum:
Meine Weltbeste und ich wohnen augenscheinlich am Meer, und zwar dergestalt, daß man von der Terrasse direkt ins Phtalogrün springen kann (ein Meer anderer Farbe kommt nicht mehr infrage, nichtmal im Traum, sozusagen) und zwischen uns wuselt ein einjähriges Kind umher, das sich mit der Zeit als unseres, also auch meines, herausstellt. Mich wundert im Traum weniger, daß da noch ein Kind ist, von dessen Geburt ich offensichtlich nichts bemerkt hatte, als daß es einen schwarzen Anzug trägt, dazu edle Schuhe, budapester aus weichem Leder, die dichten Haare mit Brillantine nach hinten geklebt, eine elegante Krawatte um den Hals. Meine Frage, warum der Kleine einen schwarzen Anzug trägt, beantwortet meine Frau, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, daß unser Jüngster eben keine Babykleidung tragen möchte, er fühle sich im schwarzen Anzug am wohlsten, daher hätte er auch einen Kasten* voll davon, was notwendig wäre, weil die Kleinen sich ja ständig schmutzig machten.
Während wir also auf der Terrasse vor dem Meer sitzen, ich in Badehose und oben ohne, Sohnemann im schwarzen Edelknitter, bemerke ich, daß vor einer Mauerritze ständig Bewegung ist, als würde dort Ungeziefer aus- und einkrabbeln. Bei näherem Hinschauen sehe ich, daß es sich nicht, wie zuerst angenommen, um Kakerlaken oder dergleichen handelt, sondern um Zebras, Giraffen, Krokodile und anderes, vorwiegend afrikanisches Getier im Miniformat, also circa zwei Zentimeter groß, das immer wieder aus der Mauerritze heraus und wieder in sie hineinströmt, wenn man sich ihm nähert. Anscheinend haben die kleinen Wildtiere aber mehr Vertrauen zu einem Anzug- als zu einem Badehosenträger, und so gelingt es unserem Sohn immer wieder mal, ein Tierchen zu fangen und in eine Schachtel zu geben. Als er seiner Meinung nach genug gesammelt hat, kommt er zu mir und zeigt stolz seinen Fang. Ich weiß nicht genau, ob ich mich über meinen anzugtragenden Kleinwildjäger freuen soll, da schnappt er ein Zebra, steckt es in den Mund, zerkaut es genüßlich und hält mir ebenfalls eines vor den Mund. Da mir seine zarte Kinderseele wichtiger ist als das Artenschutzabkommen, das diese Tiere eigentlich schützt, von dem ich im Traum aber ohnehin nicht sicher bin, ob es auf die Miniaturausgaben dieser Tiere anzuwenden ist, beiße ich ebenfalls in das Zebra: Interessanterweise schmeckt es nach Himbeere. die anderen Tiere haben ebenfalls Fruchtgeschmack, Ananas, Erdbeere, Banane und so weiter. Als ich nach einem mit Ingwergeschmack frage, hält mir der Sohn ein Krokodil hin, und es schmeckt tatsächlich danach. Durch den Fruchtgeschmack stellt sich die Frage nicht, ob die Tiere eigentlich leiden, wenn man in sie lebendigen Leibes hineinbeißt, schließlich bewegen sie sich fröhlich hin und her, während man sie in den Mund schiebt. Als die Schachtel leer ist, fragt Sohnemann mit den Augen, er kann anscheinend noch nicht sprechen, ob er noch Tiere holen soll, was ich verneine. Da fängt er zu weinen an, kramt in seinen Hosentaschen, zieht einen Autoschlüssel hervor, den ich nicht kenne, und wirft ihn im weiten Bogen ins Meer.
An dieser Stelle bin ich dann laut lachend aufgewacht.
Meine Weltbeste und ich wohnen augenscheinlich am Meer, und zwar dergestalt, daß man von der Terrasse direkt ins Phtalogrün springen kann (ein Meer anderer Farbe kommt nicht mehr infrage, nichtmal im Traum, sozusagen) und zwischen uns wuselt ein einjähriges Kind umher, das sich mit der Zeit als unseres, also auch meines, herausstellt. Mich wundert im Traum weniger, daß da noch ein Kind ist, von dessen Geburt ich offensichtlich nichts bemerkt hatte, als daß es einen schwarzen Anzug trägt, dazu edle Schuhe, budapester aus weichem Leder, die dichten Haare mit Brillantine nach hinten geklebt, eine elegante Krawatte um den Hals. Meine Frage, warum der Kleine einen schwarzen Anzug trägt, beantwortet meine Frau, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, daß unser Jüngster eben keine Babykleidung tragen möchte, er fühle sich im schwarzen Anzug am wohlsten, daher hätte er auch einen Kasten* voll davon, was notwendig wäre, weil die Kleinen sich ja ständig schmutzig machten.
Während wir also auf der Terrasse vor dem Meer sitzen, ich in Badehose und oben ohne, Sohnemann im schwarzen Edelknitter, bemerke ich, daß vor einer Mauerritze ständig Bewegung ist, als würde dort Ungeziefer aus- und einkrabbeln. Bei näherem Hinschauen sehe ich, daß es sich nicht, wie zuerst angenommen, um Kakerlaken oder dergleichen handelt, sondern um Zebras, Giraffen, Krokodile und anderes, vorwiegend afrikanisches Getier im Miniformat, also circa zwei Zentimeter groß, das immer wieder aus der Mauerritze heraus und wieder in sie hineinströmt, wenn man sich ihm nähert. Anscheinend haben die kleinen Wildtiere aber mehr Vertrauen zu einem Anzug- als zu einem Badehosenträger, und so gelingt es unserem Sohn immer wieder mal, ein Tierchen zu fangen und in eine Schachtel zu geben. Als er seiner Meinung nach genug gesammelt hat, kommt er zu mir und zeigt stolz seinen Fang. Ich weiß nicht genau, ob ich mich über meinen anzugtragenden Kleinwildjäger freuen soll, da schnappt er ein Zebra, steckt es in den Mund, zerkaut es genüßlich und hält mir ebenfalls eines vor den Mund. Da mir seine zarte Kinderseele wichtiger ist als das Artenschutzabkommen, das diese Tiere eigentlich schützt, von dem ich im Traum aber ohnehin nicht sicher bin, ob es auf die Miniaturausgaben dieser Tiere anzuwenden ist, beiße ich ebenfalls in das Zebra: Interessanterweise schmeckt es nach Himbeere. die anderen Tiere haben ebenfalls Fruchtgeschmack, Ananas, Erdbeere, Banane und so weiter. Als ich nach einem mit Ingwergeschmack frage, hält mir der Sohn ein Krokodil hin, und es schmeckt tatsächlich danach. Durch den Fruchtgeschmack stellt sich die Frage nicht, ob die Tiere eigentlich leiden, wenn man in sie lebendigen Leibes hineinbeißt, schließlich bewegen sie sich fröhlich hin und her, während man sie in den Mund schiebt. Als die Schachtel leer ist, fragt Sohnemann mit den Augen, er kann anscheinend noch nicht sprechen, ob er noch Tiere holen soll, was ich verneine. Da fängt er zu weinen an, kramt in seinen Hosentaschen, zieht einen Autoschlüssel hervor, den ich nicht kenne, und wirft ihn im weiten Bogen ins Meer.
An dieser Stelle bin ich dann laut lachend aufgewacht.
* Kasten: aus dem Österreichischen = gleich Schrank.
| Di, 02.10.2012 | link | (7888) | 2 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Gastrosophisches |
Büschelweise Haare in der Suppe
Als Fünfjährige mochte ich, wie die meisten meiner Altersgenossen, keine Suppen, Eintöpfe und Brühen wie jedwede Art von Flüssignahrung waren mir ein Graus. Breis, Crèmes, Puddings, Süßes und Klebriges durften es, obwohl auch gelöffelt, schon sein, aber glibberige Hühnerhaut, Ochsenschwänze oder Suppenfleisch mit Speckschwarte: nein danke.
Schließlich ist die Bezeichnung Bouillon schon im Krieg der Knöpfe ein Schimpfwort. (Wer will schon Hühnerbrüh heißen?) Feste, trockene und fein säuberlich getrennte Lebensmittel entsprechen offenbar mehr dem altersgemäßen Wunsch nach Differenzierung und Entwicklung. Dabei reproduziert das Kind hier recht anschaulich einen Ausschnitt Kulturgeschichte bzw. Zivilisationsprozeß.
«Zuerst wird die Suppe oft getrunken, sei es aus dem gemeinsamen Napf oder aus Kellen, die mehrere benutzen. In den courtoisen Schriften (courtoise als Inbegriff des gesellschaftsfähigen Verhaltens an den Höfen der größeren, ritterlichen Feudalherren im 13. Jahrhundert) wird vorgeschrieben, sich des Löffels zu bedienen:
mit der schüzzel man niht sufen soll,
mit einem lefel, daz stat wol (Tannhäuser zugeschrieben).
Auch sie (die Löffel) werden zunächst mehreren gemeinsam gedient haben. Einen weiteren Schritt zeigt das Zitat von Calviac aus dem Jahre 1560. Er erwähnt, daß es unter Deutschen Brauch sei, jedem Tischgenossen seinen eigenen Löffel zu lassen. Den nächsten Schritt zeigt Antoine de Courtins Mitteilung aus dem Jahre 1672. «Man ißt jetzt nicht mehr die Suppe unmittelbar aus der gemeinsamen Schüssel, sondern schüttet sich etwas davon auf den eigenen Teller, und zwar zunächst mit dem eigenen Löffel. [...] Hier stellt sich Schritt für Schritt jene Art, die Suppe zu nehmen, her, die inzwischen selbstverständlich geworden ist: Jeder hat seinen eignen Teller, jeder seinen eigenen Löffel. Sie wird mit einem spezialisierten Gerät ausgeschenkt», beschreibt Norman Elias die Entwicklung und faßt weiterhin zusammen: «Nichts an den Verhaltensweisen bei Tisch ist schlechthin selbstverständlich, gleichsam als Produkt eines ‹natürlichen› Peinlichkeitsgefühls. Weder Löffel, noch Gabel, oder Serviette werden einfach wie ein technisches Gerät, mit klar erkennbarem Zweck und deutlicher Gebrauchsanweisung eines Tages von einem Einzelnen erfunden; sondern durch Jahrhunderte wird unmittelbar im gesellschaftlichen Verkehr und Gebrauch allmählich ihre Funktion umgrenzt, ihre Form gesucht und gefestigt. Jede noch so kleine Gewohnheit setzt sich unendlich langsam durch , selbst Verhaltensweisen, die uns ganz elementar erscheinen oder ganz einfach ‹vernünftig›, etwa der Brauch, Flüssiges nur mit dem Löffel zu nehmen; jeder Handgriff, die Art, in der man Messer, Löffel oder Gabel hält und bewegt, wird nicht anders als Schritt für Schritt standardisiert. Und auch der gesellschaftliche Mechanismus dieser Standardisierung zeichnet sich in Umrissen ab, wenn man die Bilderreihe als Ganzes überblickt: Es gibt einen mehr oder weniger begrenzten, höfischen Kreis, der die Modelle prägt, und zwar zunächst offenbar nur für die Bedürfnisse der eigenen, gesellschaftlichen Situation und entsprechend der Seelenlage, die dieser sozialen Lage entspricht.»
Für das Kind erzählt der Eßtisch aber nicht nur anthropologische Kuriositäten. Er ist vor allem Schauplatz bzw. Schlachtplatz der Erziehung. Mit der Suppe werden dem Sprößling zugleich Manieren und Machtverhältnisse eingeflößt. Schon mit dem ersten Süppchen soll es lernen zu essen, was auf den Tisch kommt, nicht so zu schlingen, nicht zu schlürfen und nicht so (vor Lust) zu schmatzen, nicht (mit vollem Mund) zu sprechen und dabei außerdem gerade zu sitzen sowie sich überhaupt endlich besser zu benehmen, kurz, den so erzeugten Widerstand, gleich ob in Richtung Maßlosigkeit oder Nahrungsverweigerung, schleunigst aufzugeben. Daß es aber wenig Verlockendes hat und beinahe einem Rückfall gleichkommt, nach Jahren meist unfreiwilliger, mühsamer Anstrengungen wieder auf den Löffel zurückgreifen zu müssen, da man doch froh ist, wie die elterlichen Vorbilder endlich mit Messer und Gabel zustechen zu können oder zu dürfen, sollte auch Erwachsenen einleuchten. Daß dem in den meisten Fällen nicht so ist, tut selbstverständlich nichts zur Sache.
Wie auch immer besorgte Eltern ihrem Nachwuchs die Flüssignahrung schmackhaft machen wollen, es scheint nicht verhindern zu können, daß dieser letztendlich doch noch auf den Geschmack kommt. In Zeiten verstärkter seelischer oder sich sonstwie äußernder Bedrängnis greift der Mensch neben anderen Sedativa auch gerne auf heiße, dampfende Suppen zurück, versucht er, die vermißte Wärme sozusagen aus der Suppe zu extrahieren. Wie sonst ließe sich erklären, daß ich mir am schuleigenen Getränkeautomaten statt Milch oder Limonade (Coca-Cola gab es natürlich nicht) lieber einen Becher salziger Gemüsebrühe zog und Menschen, die dieses Frühsymbol per se nicht anrühren, so rar sind.
Suppe und Löffel repräsentieren frühe Erfahrungen von wenn auch nicht immer überzeugend liebevoller Versorgung, so doch Befriedigung. Dabei spielt der Löffel als das «erste Bemächtigungsmittel der Welt» eine entscheidende Rolle. «Mit Messer, Gabel, Schere, Licht spielen kleine Kinder nicht.» Der Löffel aber ist das Werkzeug, das dem Kleinkind anvertraut wird, mit dem es erstmals nachhaltige Eingriffe tätigt, mit dem es sich quasi der Welt bemächtigt. Indem das Kind mit dem Löffel Dinge (wenn auch nur Speisebrocken) ungestraft verschwinden lassen kann (wenn auch nur im eigenen Mund), erlebt es Selbsteffizienz. Das verleiht dem Löffel eine hohe symbolische Bedeutung. Dazu ist die Rundung dieses Werkzeugs nicht nur in ergonomisch idaler Weise dem Mund und damit der nehmenden Funktion angepasst, seine Wölbung erinnert an die Innenseite des Handtellers, mit dem gegeben wird (den Arm als Stiel gedacht). Der Löffel suggeriert im Gegensatz zum Messer Geborgenheit und Gefühle des Aufgehobenseins wie in der Wiege oder im mütterlichen Schoß, versinnbildlicht die Idealvorstellung der Ausgewogenheit zwischen Geben und Nehmen. Unter der Prämisse ergibt es auch Sinn, ‹das große Fressen› im Kreise der Nächsten mit dem friedfertig-versöhnlichen Löffel zu beginnen; da sorgt sich der Schwager erst einmal weniger darum, daß ihm die Butter vom Brot genommen werden könnte und geht vielleicht nicht gleich mit dem Messer auf die anderen los.
All das macht den Löffel zum symphatischen Objekt aber auch zum Todessymbol. In Analogie zur Mahlzeit (die beim Nachtisch wieder mit dem Löffel endet), wird auch der Tod, das Ende der Ausdifferenzierung mit ihm in Verbindung gebracht: Wer sterben muß, ‹gibt den Löffel ab› und wer sich etwas eingebrockt hat, muß zurückgehen, um es wieder auszulöffeln. Das Löffeln von Suppe dient aber auch in der Regel, wenn nicht Armut oder Krankheit dazu zwingt, dem Reaktivierungsversuch früherer Glücksgefühle.
Die Suppe scheint stärker als andere Speisen für den Bauch als für den Gaumen bestimmt. Weniger Geschmackssensationen als leibliches Wohlbehagen soll sie erzeugen, wenn sich mit der Emulsion wonnige Wärme im Unterleib ausbreitet. «Weniger wegen ihres kräftigenden Nährwertes, der nach den neuesten Forschungen nicht sehr groß ist, als vielmehr um ihrer belebenden und appetitanregenden Wirkung [...] gibt man sie Appetitlosen und Rekonvaleszenten», heißt es in einem Kochbuch von 1985, und «sie (die Kraftbrühe, Boullion oder consommé) wirkt auf Magen und Nerven — wie guter Wein.» Die Suppe geht also ans Eingemachte, hat es auf Geist und Seele abgesehen — wie die Ochsenbrust auf die Muskelkraft oder die Auster auf die Libido — und rückt damit schon in die Nähe der Heilmittel.
Auch Arzneien, Hexen- und Zaubertränke werden ja wie Suppen mittels spezieller Rezepturen und Zutaten durch die chemische Prozedur des Verkochens hergestellt. (Eindrucksvolle Beispiele finden sich bei E.T.A. Hoffmanns Goldenem Topf.) Zur Suppe eingekocht scheinen Knochen, Wurzeln und Gewächse in der Lage, ozeanische Frühgefühle oder zumindest glückselige Gemütszustände herbeiführen zu können. Auf ‹Massenübereinkünften› wie dem Karneval wird die Seligkeit daher auch vorzugsweise durch Ausschank von relativ unhandlichen Erbsen- oder Gulaschsuppen induziert, obgleich hartgekochte Eier beispielsweise nicht weniger symbolträchtig und obendrein praktischer wären. Von Würstchen und Fritten immer noch unübertroffen scheint die Suppe die Regression am besten zu fördern.
Vermutlich ist sie wegen ihrer direkten Verbindung zum Bauch (sie muß ja nicht erst lange gekaut, sondern nur geschluckt werden) auch als Sinnbild des Unbewußten, des individuell Frühen und menschheitsgeschichtlichen Alten in das kollektive Unbewußte eingegangen; als möge man von Zeit zu Zeit von der Ursuppe nippen oder zumindest mit dem Löffel darin rühren.
Mehr als in allen anderen Nahrungsmitteln (Getränke gehören ja einer anderen Kategorie an) ist in ihr eine strukturelle Prädisposition für den Genuß sofort angelegt. In der Suppe liegt Magie.
Gabi Rauch
zur biographischen Notiz zur Autorin versagt leider die Erinnerung; geblieben ist die an ihre sowie der Galeristin freundliche Genehmigung zum Nachdruck aus: Suppenanstalt, Heft zur Aktion Dauerkarte. © Paszti-Bott-Galerie, Köln 1993
Laubacher Feuilleton 7.1993, S. 3
| So, 11.10.2009 | link | (2288) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Gastrosophisches |
| Mo, 20.04.2009 | link | (2408) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Gastrosophisches |
«Gestank im Ohr»
Es ist bei völlig leerem Lokal nicht ganz falsch, irgendeine Geräuschkulisse zu haben. Ob es Musik sein muß? Früher, als die meisten Restaurants noch das Buffet im Gastraum hatten, kamen von dort Arbeitsgeräusche, und es war nie so friedhofstill, wie man es nun manchmal erleben kann. Eine seltsame Entwicklung, die es notwendig macht, die Beklemmung in einem wenig frequentierten Lokal aufzulockern. Aber es scheint der falsche Weg, denn der Gast darf doch sicherlich auch hören, wie für ihn gekocht und gearbeitet wird. Es wird also gekocht, gezapft, die Korken fliegen, aber es muß nicht noch musiziert werden. Wenn nicht live, warum dann Musikkonserve, es sei denn, die ganze Kocherei entsteigt der Dose. Zugegeben, es gibt Menschen, die benötigen immer einen gewissen «Gestank im Ohr» (Ambrose Bierce), und es sind selten die wahren Musikliebhaber. Es stellt sich die Frage, hat man tatsächlich ein solch dudelverseuchtes Publikum, daß sogar bei vollbesetztem Lokal zum ganzen Lärminferno noch eins drauf muß? Ich meine nein. Für den Liebhaber der Musik hat man sowieso die falsche CD eingelegt. Geschäftsleute, die vertrauliche Gespräche führen und bei enggestellten Tischen Lauschangriffe befürchten, sind womöglich im falschen Lokal, und als Wirt muß man nicht alle Bedürfnisse abdecken und auch nicht jeden Umsatz mitnehmen wollen. Ein kleines Lokal hat seine Stärken, die ein großes nie erfüllen kann, und umgekehrt. Könnte man nicht als Wirt, auch wenn der Laden mal leer sein sollte, die Leute in Ruhe lassen oder sie sogar mit den Ohren darauf stoßen, daß Stille ein ganz seltener Luxus geworden ist? Sie ist sogar so selten geworden, daß man sich als Wirt überlegen sollte, ob bei leerem und stillem Lokal die Preise nicht anzuheben wären.
Der Autor ist uns leider abhanden gekommen.
Laubacher Feuilleton 7.1993
| Do, 19.03.2009 | link | (2057) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Gastrosophisches |
Höchst zerstreute Gedanken
Geistiges. Kreisleriana.
Man spricht so viel von der Begeisterung, die die Künstler durch den genuß starker Getränke erzwingen — man nennt Musiker und Dichter, die nur so arbeiten können (die Maler sind von dem Vorwurfe, soviel ich weiß, frei geblieben). — Ich glaube nicht daran — aber gewiß ist es, daß eben in der glücklichen Stimmung, ich möchte sagen, in der günstigen Konstellation, wenn der Geist aus dem Brüten in das Schaffen übergeht, das geistige Getränk den regeren Umschwung der Ideen befördert. — Es ist gerade kein edles Bild, aber mir kommt die Phantasie hier vor wie ein Mühlrad, welches der anschwellende Strom schneller treibt — der Mensch gießt Wein auf, und das Getriebe im Innern dreht sich rascher! — Es ist wohl herrlich, daß eine edle Frucht das Geheimnis in sich trägt, den menschlichen Geist in seinen eigensten Anklängen auf eine wunderbare Weise zu beherrschen. — Aber was in diesem Augenblicke da vor mir im Glase dampft, ist jenes Getränk, das noch wie ein geheimnisvoller Fremder, der, um unerkannt zu bleiben, überall seinen Namen wechselt, keine allgemeine Benennung hat und durch den Prozeß erzeugt wird, wenn man Kognak, Arrak oder Rum anzündet und auf einem Rost darüber gelegten Zucker hineintröpfeln läßt. — Die Bereitung und der mäßige Genuß dieses Getränkes hat für mich etwas Wohltätiges und Erfreuliches. — Wenn die blaue Flamme emporzuckt, sehe ich, wie die Salamander glühend und sprühend herausfahren und mit den Erdgeistern kämpfen, die im Zucker wohnen. Diese halten sich tapfer; sie knistern in gelben Lichtern durch die Feinde, aber die Macht ist zu groß, sie sinken prasselnd und zischend unter — die Wassergeister entfliehen, sich im Dampfe emporwirbelnd, indem die Erdgeister die erschöpften Salamander herabziehen und im eignen Reiche verzehren; aber auch sie gehen unter, und kecke, neugeborne Geisterchen strahlen in glühendem Rot herauf, und was Salamander und Erdgeist im Kampfe untergehend geboren, hat des Salamanders Glut und des Erdgeistes gehaltige Kraft. — Sollte es wirklich geraten sein, dem innern Phantasie-Rade Geistiges aufzugießen (welches ich doch meine, da es dem Künstler nächst dem rascheren Schwunge der Ideen eine gewisse Behaglichkeit, ja Fröhlichkeit gibt, die die Arbeit erleichtert), so könnte man ordentlich rücksichts der getränke gewisse Prinzipe aufstellen. So würde ich z. B. bei der Kirchenmusik alte Rhein- und Franzweine, bei der ernsten Oper Champagner, bei Kanzonetten italienische feurige Weine, bei einer höchst romantischen Komposition, wie die des ‹Don Juan› ist, aber ein mäßiges Glas von eben dem von Salamander und Erdgeist erzeugten Getränk anraten! — Doch überlasse ich jedem seine individuelle Meinung und finde nur nötig für mich selbst im stillen zu bemerken, daß der Geist, der, von Licht und unterirdischem Feuer geboren, so keck den Menschen beherrscht, gar gefährlich ist und man seiner Freundlichkeit nicht trauen darf, da er schnell die Miene ändert und, statt des wohltuenden, behaglichen Freundes, zum furchtbaren Tyrannen wird.
E. T. A. Hoffmann
Laubacher Feuilleton 2.1992, S. 2
E.T.A. Hoffmanns Werke in fünfzehn Teilen, Deutsches Verlagshaus Bong & Co., Berlin – Leipzig – Wien – Stuttgart, etwa 1912, Band 1–2, S. 61–62
| Di, 17.03.2009 | link | (1686) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Gastrosophisches |
Mark Twain ißt in Europa
Das europäische Mittagessen ist besser als das europäische Frühstück, aber es hat seine Fehler und Mängel, es sättigt nicht. Der Verbannte kommt gierig und hungrig an den Tisch, er schluckt die Suppe hinunter — irgend etwas Unbestimmtes fehlt an ihr; er denkt, der Fisch werde das sein, was er braucht — er ißt ihn und ist sich dessen nicht sicher; er denkt, der nächste Gang werde vielleicht derjenige, der die hungrige Stelle trifft — er versucht ihn und merkt, daß auch daran irgend etwas fehlt. Und so macht er weiter, von Gang zu Gang, wie bei einem Jungen, der hinter einem Schmetterling her ist, welchen er jedesmal, wenn er sich niederläßt, beinahe erwischt, aber schließlich irgendwie überhaupt nicht bekommt; und zum Schluß ist es dem Verbannten und dem Jungen ungefähr gleichergangen: Der eine ist voll, aber nicht satt, der andere hat viel Bewegung, viel Spannung und eine schöne Menge Hoffnungen gehabt, aber er besitzt keinen Schmetterling. Hier und da sagt ein Amerikaner, er könne sich erinnern, von einer europäischen Table d'hôte vollkommen satt aufgestanden zu sein; aber wir dürfen nicht übersehen, daß auch hier und da mal ein Amerikaner vorkommt, der lügt.
Die Anzahl der Gänge reicht aus; aber es ist eben eine so monotone Vielfalt unbeeindruckender Gänge. Es ist eine leblose Eintönigkeit von ‹gut bis mittelmäßig›. Es gibt keine Akzente. Wenn vielleicht der Hammel- oder Rindsbraten — ein großer, ordentlicher — auf dem Tisch käme und in voller Sicht des Gastes aufgeschnitten würde, könnte das der Sache den richtigen Anstrich von Gediegenheit und Greifbarkeit geben; aber das machen sie nicht, sie reichen das in Scheiben geschnittene Fleisch auf einer Platte herum, und so bleibt man vollkommen unbewegt, es regt einen überhaupt nicht auf. Aber ein riesiger gebratener Truthahn, breit auf den Rücken gelegt, die Füße in die Luft, und der kräftige Saft rinnt ihm aus den fetten Seiten ... aber ich kann ebensogut hier abbrechen, denn sie wüßten ja nicht, wie sie ihn zubereiten sollten. Nicht einmal ein Huhn können sie anständig kochen; und was das Tranchieren angeht, so besorgen sie das mit dem Beil.
Mark Twain
Laubacher Feuilleton 7.1993, S. 1
Poeten tischen auf, ein kulinarischer Streifzug durch die Weltliteratur, unternommen von Günther Cwoidrak, Eulenspiegel Verlag, Berlin 1987, S. 131 und 132
| Di, 17.03.2009 | link | (1508) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Gastrosophisches |
Frische(r) Wahn
Vollkorn und Verfolgungsangst
Für unsere Betrachtung nehmen wir nichts Verrücktes aus dem Reformhaus, sondern einen «normalen», «allgemein anerkannten», ebenso teuren wie erfolgreichen Markenartikel. Hier der um Vertrauen werbende Text auf der Verpackung (ohne die Anweisung, wie die Packung zu öffnen sei, ohne Wiederholungen und die detaillierte Einschärfung, der Artikel passe ideal zu allen überhaupt möglichen Mahlzeiten): «ROGGI-BRÖD ist Vollkornbrot, aus dem mahlfrischen Mehl erlesenen Roggens behutsam gebacken. Vitamine, Mineralien und Nährstoffe des ungeschälten Roggenkorns bleiben dabei unversehrt erhalten. Das ergibt ein gesundes, nahrhaftes Vollkornbrot von köstlichem Aussehen, Duft und Wohlgeschmack. Seine Knusprigkeit regt zum guten Kauen an. Das beugt der Zahnkaries vor. Dank leichter Verdaulichkeit und niedrigem Kalorienwert — ein wahrer Freund der schlanken Linie».
«Aus Vollkornroggen, Hefe und frischem Quellwasser»
«das gute, echte Knäckebröd aus Schweden»
«aus den größten Knäckebrotwerken der Welt».
Der topos des Rekords als des Erfolgs, der weiteren Erfolg nach sich zieht (Motto: «thirteen million Americans can't be wrong»), ist am leichtesten zu lesen. Wir werden später seine Verwandtschaft zum terroristischen Modell von Reklame zu erweisen suchen (vgl. den Typus «man ist man»). Auf dem Wege der Assoziation und der Umkehrung versuchen wir nun, die übrigen Elemente zu interpretieren. Im «Vollkorn» klingt «Erfüllung» an, «Ganzheitlichkeit». Sein Name sagt, es sei voll und ganz Korn (und keine Ware). Der Name ist magisch, er beschwört, die Leere im Versprechen von ihr zu befreien. Indem er gegen sie versichern soll, deutet er auf das tatsächlich herrschende Gefühl von Leere, und das heißt: von Betrogensein um die Fülle der Dinge. «Vollkorn» weist auf die aktuelle Haben-Form der Dinge, vor allem für die ökonomisch Abhängigen: überdeckt von der platten Pracht der in allen Anilinfarben blühenden Verpackungen sind die «Sachen selbst» zu Schemen verblaßt und in ihrer äußerlich versprochenen Substanz bald so wenig faßbar wie das sagenhafte «Ding-an-sich» des bürgerlichen Agnostizismus. Ästhetik und Gebrauchsleib der Massenwaren sind dissoziiert und durch die Dissoziation beide beschädigt. Daß über den miesen Inhalt die strahlende Verpackung triumphiert, diskreditiert mit dem Inhalt den Triumph der Strahlen. Die Lust am Glanze wird falsch. Alles Fruchtige floß in die Hülle, und die Hülse droht leer zu sein. Daher: voll Korn.
Die Lobrede, die mit Vollkorn anhub, endet mit der Versicherung, «R» sei «ein wahrer Freund der schlanken Linie». Heißt das: es gibt nicht nur ein Verlangen nach Fülle, sondern auch Angst davor? Fühlen wir uns von den Genüssen verfolgt, die wir verfolgen? Müssen wir in Freunden Feinde fürchten, so daß es der beschwörenden Qualifizierung «wahrer Freund» bedarf? Wie die verdinglichten Menschen «fühlen sich» auch die kapitalisierten Dinge verfolgt. Die Konzentration und Zentralisation ihrer Produktion, d. h. ihre Vergesellschaftung innerhalb der Schranken des Privatbesitzes, räumt weitgehend auf mit den objektiven Unterschieden der «konkurrierenden» Markenartikel. Am Ende unterscheiden sich fast nun mehr die Artikelmarken. Das Besondere einer Ware hat seinen Ort jetzt in der Verpackung, die zugleich ihre zweite Oberfläche und ihre Maske ist, unter der sich ihre Unterschiedslosigkeit verbirgt. Wo aber tendenziell nur noch die Werbeveranstaltungen der Waren «konkurrieren», nimmt Werbung wahnhafte Züge an. In ihnen drückt sich eine Art Verfolgungswahn der Waren aus, der, wie man Freud umschreiben könnte, gesetzmäßig aus der Abwehr überwiegend gleichartiger Beschaffenheit von Waren hervorgeht, die zwanghaft Verschiedenheit beanspruchen müssen. Der Zwang zur unverwechselbaren Besonderheit spiegelt den kapitalistischen Charakter ihrer Produktion wider. Wäre ihre Produktion nicht nur der Stufenleiter, sondern auch der Form nach gesellschaftlich, entfiele dieser Zwang zum falschen Schein des Besonderen. Der Zwang zur scheinbaren Ungleichheit ist allen kapitalistisch, d. h. privat produzierten Waren, gemein. In den Erscheinungen der Waren drückt sich dieser Widerstreit aus: sie sehen aus, als fühlten sie sich von der Gleichheit der Warencharaktere verfolgt. Um sich als etwas Besonderes von den konkurrierenden Waren abzusetzen, müssen sie im Namen ihrer Marke den Abstammungsnachweis unverwechselbarer Qualität erbringen. Um diesen Nachweis wiederum leisten zu können, müssen sie sich wie irre mit ihrer dem Stand der Produktivkräfte wie der weitgehenden Zentralisation ihrer Herstellung verdankten massenhaften und standardisierten Produzierbarkeit herumschlagen. Daß sie hochproduktiv und in riesenhaften Quantitäten hergestellt werden können, müssen sie, um sich als «Marke» zu behaupten, wie einen Makel der Abkunft zu verdecken suchen.
«R» beteuert Einmaligkeit und Ursprungsnähe: «mit frischem Quellwasser» ist das «mahlfrische Mehl erlesenen» — das heißt: nicht für die Massen, sondern für eine Konsumelite bestimmten — Roggens zubereitet. Der Fabrikationsprozeß muß sich zur «Behutsamkeit» bescheiden: nur ganz unwesentlich sei das Natürliche umfabriziert. Gegen die Schattenseiten des Fabrikatcharakters, Konserve zu sein — das heißt: zeitlos, vor Vergänglichkeit «bewahrt» — protestieren die Versicherungen von Unmittelbarkeit und Frische. «Frisch» spekuliert wiederum auf gesellschaftlich durchaus begründete Zwangsvorstellungen der Menschen. Die Angst, veraltet zu sein, abgestanden, wird angetippt in dem Wörtchen «frisch», das sechsmal auf jeder Packung fungiert, davon dreimal in Zusammensetzungen («mahlfrisch», «Frischhalte»).
«Frisches Quellwasser» kann zunächst als Symbol für eine unbefleckte und quellend unverdinglichte Lebensart gelesen werden. Es wird aber mehr noch die latente Angst und Sehnsucht — im Modus der Enttäuschung — derer ansprechen, die von den Profitinteressen abgespeist werden mit abgestandenen Surrogaten, und dies in einer «Umwelt», die von denselben Profitinteressen rücksichtslos in einer Weise verwertet wird, die Verwüstung und nicht nur Verschmutzung genannt zu werden verdient. Für die in der Großindustrie und den großen industriellen Zentren arbeitenden Massen wird «frisches Quellwasser» zum Topos aus der ihnen als Sprache der Waren gegenübertretenden Mythologie ihrer Sehnsüchte. Dem verwerteten Leben verspricht die Werbung Gesundung in topoi der idyllischen Naturästhetik Rousseaus: «Unversehrtheit», «Naturreinheit», «Gesundheit», «ungeschält» und «von köstlichem Aussehen, Duft und Wohlgeschmack». Liegt in «bleiben» und «erhalten» der Akzent auf konservativen Reizworten, so regrediert im Onkel-Doktor-Ton der Scheinaufklärung über Mineralien und Lebensstoffe sowie im kindischen Kosenamen «Roggi» das dieser Werbung entsprechende Bewußtsein vollends ins Infantile. Die Werbung beutet aus und befestigt so, indem sie mit dem Antiurbanismus die Vernunftmüdigkeit anspricht, ein reaktionäres Gefüge von Wahnideen und ins Infantile zielenden Symbolen. Im Wahn steckt jedoch soviel Wahrheit, daß die Welt, in der er seine Wirkung nicht verfehlt, immer irrationaler in ihren Zielen wird. Man hat allen Anlaß, sich vor falschen Freunden zu hüten. Genuß ist verfälscht oder rächt sich. Nichts hält, was es verspricht. Und was dir etwas verspricht, bedroht dich auch. Das Ganze wird immer schwerfälliger und undurchsichtiger. Inmitten des Reichtums sind wir frustriert und verflucht: wenn wir uns nicht der Befriedigung enthalten, um derentwillen wir uns zur Leistung antreiben ließen, müssen wir Angst haben, zu verfetten und mit verfallenden Zähnen aus dem Verfolgungsrennen auszuscheiden. Der von den irren Verhältnissen produzierte Wahn und selbst das Echo, das er im Irrsinn der manipulativen Phänomene findet, ist «der Ersatz für den Traum, daß die Menschheit die Welt menschlich einrichte, den die Welt der Menschheit hartnäckig austreibt», wie die kritische Theorie den Sachverhalt umschrieb.
Wolfgang Fritz Haug
Laubacher Feuilleton 9.1994, S. 7
Wolfgang Fritz Haug, Warenästhetik, Sexualität und Herrschaft Gesammelte Aufsätze, Frankfurt am Main 1972, S. 33–36
| Di, 17.03.2009 | link | (2230) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Gastrosophisches |
Käse hält aufrecht
Frankreich — die wunderbare Illusion
Saint Uguzon bewahrt meinen Freund Roland und alle anderen Käsehändler vor Wahlen und anderem Übel. Weil ich mich vor Roland nicht nur im Umgang mit diesen edlen Faulprodukten gelehrig gezeigt hatte, sondern auch mit Abscheu deutschen Protektionismus ablehnte, der nur noch hygienischen Käse, was ein Widerspruch in sich ist, über die Grenzen lassen wollte, wurde ich nach eingehender Prüfung gebeten, an einem Chapitre, einer Würdigung für Saint Uguzon, teilzunehmen.
Am Ehrentisch sitze ich neben dem noch leeren Stuhl von Pierre Androuet, dem Gründer und Prèvot der Confrérie, wie ich seiner Tischkarte entnehme. Gegenüber das Ehepaar Rappaport. Roland Rappaport ist Rechtsanwalt. Wir sind — obwohl «Nichtkäseleute» — auserwählt, heute abend zu Compagnons de Saint Uguzon ernannt zu werden. Die Kapelle schmettert ohrenbetäubend los. Wir erschrecken, doch wird uns schlagartig klar, daß hier nur der Einmarsch des «Präsidiums» musikalisch untermauert wird.
Um den Hals hängt ihnen allen eine große Kette, an deren Ende eine handtellergroße Medaille baumelt. Später werden wir erkennen, daß diese alle gleich wirkenden Medaillen kleine Gradunterschiede aufweisen. Ein einfacher Compagnon de Saint Uguzon hat einen silbernen Rand. In der nächsthöheren Stufe erscheint das untere Drittel mit den Worten «Fromages maintiendront» (Käse hält aufrecht) in Gold. In der höchsten Stufe glitzert die ganze Medaille aus Gold und bedeutet «Maitre fromager».
In der Käsegilde haben sich diejenigen zusammengeschlossen, die für Qualität des Käses in Herstellung und Verkauf bürgen. Da es in Frankreich weder ein geregeltes Gesellen- noch ein Genossenschaftswesen wie in der Bundesrepublik gibt, gründen Produzenten und Fachleute, die auf Qualität achten, ihre eigenen Confréries, in denen nur diejenigen aufgenommen werden, die ihren Ansprüchen genügen. Die Confrérie de Saint Uguzon betreibt Werbung für ihre Mitglieder und sorgt für neue Kontakte.
Die edlen Damen und Herren des Präsidiums begeben sich zu der mit Spanplatten belegten Tanzfläche und stellen sich mit Rücken zu den Musikern auf. In ihrer Mitte vor dem Mikrophon Pierre Androuet, ein älterer, stämmiger Mann, vielleicht einsfünfundsechzig groß, der das Wort ergreift. Über siebzig wird er sein, der Karajan der französischen Fromagerie. Ja, ohne Hemmung darf man in Frankreich einen solchen Käsehändler mit Karajan vergleichen — wer die Papillen göttlich kitzelt, gilt dem als ebenbürtig, der über das Ohr eine Traumwelt entfaltet. Was für eine imposante Figur, dieser Prévot, mit seinem weit ausladenden Bart. Selbstsicher eröffnet er die Sitzung, einige Männer tragen über ihrem linken angewinkelten Unterarm eine Anzahl Schärpen mit Medaillen. Und dann wird aufgerufen, wer die Ehre hat, zum Compagnon de Saint Uguzon ernannt zu werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, man muß die Erhöhung schon verdient haben, und deshalb bedarf es zweier Bürgen, die vorschlagen, was der Vorstand genau überprüft.
Nachdem Roland mich gefragt hatte, ob ich die Ehre annehmen würde, hat er sein Präsidium auf mich aufmerksam gemacht, denn ich hatte in einem Film über seinen Käseladen den französischen Käse mit Verve in Deutschland verteidigt.
Das war ein Kampf, meine Damen und Herren! Da hatte man einen Prozeß in Freiburg angestrengt, ob ein wunderbar gereifter Käse noch als Nahrungsmittel verkauft werden dürfe. Ein solch affinierter Chèvre sieht wie ein gräulich-grüner Schimmelhaufen aus, was den Kenner auch nicht verwundert, denn der Schimmel ist es ja, der das Kasein verwandelt und — und bei richtiger Temperatur gerade lang genug gelagert — im Innern eine Köstlichkeit verbirgt.
Die Kartoffel hat man einst verboten, weil man von ihr Lepra bekam: Die Unwissenden hatten statt der Knolle die Blüte gegessen, und davon war ihnen übel geworden. Nun meinten die klagenden Deutschen wohl, der Schimmel müsse mitgegessen werden! Im Freiburger Käseprozeß ging es in Wirklichkeit um Protektionismus. Die deutsche Käseindustrie wollte die französischen Produkte vom Markt fernhalten. Bis in den Bundesrat hat es ein Gesetzentwurf gebracht, wonach die Einfuhr von Käse aus nichtpasteurisierter Milch aus «hygienischen» Gründen untersagt werden sollte.
Ein deutscher Käse entspricht einem Putzmittel: Der steht da, riecht sauber, sieht auch so aus und läuft nicht fort; das verdankt er der pasteurisierten Milch, aus der er hygienisch hergestellt worden ist.
Ein französischer Käse ist ein Lebewesen. Von einem Handwerker wird er — so er besondere Qualitäten erhalten soll — nach alten Rezepten aus roher Milch geformt, und seine Güte erhält er erst durch einen ständigen Reifungsprozeß.
Roland Barthélmys Ruf als Käsehändler beruht auf seiner Kunst, Käse in seinem eigenen Keller nachreifen zu lassen und erst dann zu verkaufen, wenn er den geschmacklichen Höhepunkt erreicht hat. Wer bei Roland kauft, der sagt einer seiner rosa gekleideten Verkäuferinnen, womit er vorher die Gäste bewirten wird und wann — heute abend, morgen abend — der Käse gegessen werden soll, ob er den Pouligny eher trocken oder cremig mag, ob der Saint-Marcellin stärker oder weniger nach Stall schmecken soll.
Die deutsche Käseindustrie, die erhebliche Mengen ‹sauberen› Käses aus dem Allgäu oder Bayern (das kann durchaus identisch sein, bemerkt, mit Gruß nach Hamburg, die Redaktion) an französische Supermärkte verkauft, wollte nun verhindern, daß die Deutschen auf den Geschmack kommen und unter dem Schimmel etwas noch Köstlicheres entdecken. Gott sei Dank wachte irgendwer in Bonn noch auf, und das Anti-Käsegesetz wurde zu Fall gebracht.
Ulrich Wickert
Laubacher Feuilleton 7.1993, S. 4 und 5
Den Beitrag (© 1989 Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg) hatten wir entnommen dem 1993 erschienenen ELAN. Das Kulturmagazin von ERATO, Frankreichs Klassiklabel Nr. 1. Ulrich Wickert hatte uns damals freundlicherweise die Genehmigung erteilt. Daß wir ihn — wie viele andere Beiträge aus dem Laubacher Feuilleton — hier erneut veröffentlichen, hat einmal mehr mit der Aktualität zu tun. Ein Kommentar zu diesem ganzen Käse findet sich hier.
| Fr, 13.03.2009 | link | (2485) | 0 K | Ihr Kommentar | abgelegt: Gastrosophisches |
weiterblättern ist das anwachsende Archiv der édition csc, mittlerweile in aktueller Fortsetzung. Partenaire, Partner.
Letzte Aktualisierung: 05.12.2013, 18:31
Zum Kommentieren bitte anmelden.
Links:
... Aktuelle Seite
... Inhaltsverzeichnis
... Autorinnen und Autoren
... Inwendiges
... Impressum
... Blogger.de
... Spenden
Letzte Kommentare:
/
Biographische Notiz
(edition csc)
/
Martin Knepper
(edition csc)
/
Enzoo (52 [2.10.2012]):
(edition csc)
/
Liebe virtuelle Verleger,
(edition csc)
/
Unglaublich
(jean stubenzweig)
/
Herbert Köhler
(edition csc)
/
Das sehen wir
(edition csc)
/
Guter Artikel!
(wolfganggl)
/
nur konsequent, dass storck...
(vert)
/
Telephon-Spiele
(edition csc)
/
Ein Porträt
(edition csc)
/
Unser Häus'chen
(daniel buchta)
/
Die bagonalistische Ballastung
(edition csc)
/
Dictionnaire
(edition csc)
/
Eine Antwort
(edition csc)
/
Please copy
(einemaria)
/
kid37, "We learned more from...
(kreuzbube)
/
Der bildenden Zeitung
(edition csc)
/
Da sieht man es. Nicht in...
(kid37)
Privatsphäre:
Suche:
Links:
... Aktuelle Seite
... Inhaltsverzeichnis
... Autorinnen und Autoren
... Inwendiges
... Impressum
... Blogger.de
... Spenden
Letzte Kommentare:
/
Biographische Notiz
(edition csc)
/
Martin Knepper
(edition csc)
/
Enzoo (52 [2.10.2012]):
(edition csc)
/
Liebe virtuelle Verleger,
(edition csc)
/
Unglaublich
(jean stubenzweig)
/
Herbert Köhler
(edition csc)
/
Das sehen wir
(edition csc)
/
Guter Artikel!
(wolfganggl)
/
nur konsequent, dass storck...
(vert)
/
Telephon-Spiele
(edition csc)
/
Ein Porträt
(edition csc)
/
Unser Häus'chen
(daniel buchta)
/
Die bagonalistische Ballastung
(edition csc)
/
Dictionnaire
(edition csc)
/
Eine Antwort
(edition csc)
/
Please copy
(einemaria)
/
kid37, "We learned more from...
(kreuzbube)
/
Der bildenden Zeitung
(edition csc)
/
Da sieht man es. Nicht in...
(kid37)
Privatsphäre:
Suche: